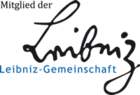Altstraßenforschung als Archäoprognose - Methodische Überlegungen zu (prä-)historischen Wegen am Beispiel Westlicher Bodensee
| Titel: | Altstraßenforschung als Archäoprognose - Methodische Überlegungen zu (prä-)historischen Wegen am Beispiel Westlicher Bodensee = Between historical geography and archaeology - methodical considerations on the research of (pre-)historical roads |
|---|---|
| Verfasser: | |
| Beteiligt: | ; |
| Körperschaft: | |
| Veröffentlicht: | Freiburg : Universität, 2020 |
| Umfang: | Online-Ressource |
| Format: | E-Book |
| Sprache: | Deutsch |
| Hochschulschrift: | Dissertation, Universität Freiburg, 2019 |
X
| Zusammenfassung: |
Abstract: Die Erforschung von historischen Wegen hat eine 150 Jahre lange Tradition. Im Jahr 1969 legte Prof. Dr. Dietrich Denecke mit seiner, im wahrsten Sinne wegweisenden Dissertation die wissenschaftliche Basis für unzählige Forschungen. Seitdem entwickelten sich durch neue Techniken getriebene Methoden und Werkzeuge, zeigten andere Wissenschaftsdisziplinen neue Denkansätze und Konzepte im Umfeld von Wegen auf und es stehen heute umfangreichere Quellen und digitale Geodaten zur Verfügung. Allerdings bleibt das Desiderat einer aktualisierten, interdisziplinären Methodenübersicht und von Theoriemodellen zu prähistorischen Wegen. <br><br>Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine methodische Vorgehensweise zu entwickeln, um Abschnitte von (prä-)historischen Landwegen mithilfe der traditionellen Altstraßenforschung und interdisziplinärer Forschungsergebnisse identifizieren zu können. Sie will damit im Rahmen der ehrenamtlichen Denkmalpflege einen aktuellen Beitrag zur Altstraßenforschung in Baden-Württemberg leisten.<br><br>Zunächst wird auf Grundlage der geographischen und archäologischen Altstraßenforschung das Untersuchungsobjekt mit seinen drei Komponenten Straßenkörper, Linienführung und Wegbegleiter definiert und die vielfältigen Quellen und Herausforderungen diskutiert. Diesen ursprünglichen Forschungsansatz der Historischen Geographie erweitern moderne Theorien, Konzepte und Modelle aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die archäologischen Wissenschaften. So liefert die archäologische Mobilitätsforschung indirekte Belege und analysiert die Ursachen und Motive von Fortbewegung. Das Modell des „Lebenszyklus von dauerhaften Gegenständen“ der archäologischen Taphonomie und deren natürliche und anthropogene Prozesse strukturieren ältere Forschungen neu. Mit dem weit verbreiteten GIS-gestützten Prognosemodell („Least-cost path“) können Landschaftskorridore für potenzielle Wege prognostiziert werden und selbst die neuen überraschenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse der Paläogenetik und der Isotopenanalyse über die Verbreitung des homo sapiens werfen neue Ansatzpunkte für die Entstehung und Entwicklung von Wegen auf. Zusätzlich dokumentieren Untersuchungen aus der Landschafts- und Städteplanung bzw. Verkehrspsychologie die physiologischen Grundlagen für Mobilität und die Wahrnehmung, Orientierung sowie Navigation im Raum. <br><br>Alle aufgezeigten interdisziplinären Komponenten müssen einzeln kritisch diskutiert und bewertet werden: Welche Auswirkungen auf die physischen Wege sind zu erwarten bzw. welche neuen Aspekte zu einer zukünftigen Wegeforschung, insbesondere auch von prähistorischen Wegen, können sie beisteuern.<br><br>Die räumliche Suche nach Objekten erfolgt in der Geoinformatik üblicherweise über die GIS-gestützte Standortsuche („site selection“), wie sie auch für die least-cost path Modellierung eingesetzt wird. Diese Methodik ist allerdings nur der zweite Schritt des wissenschaftlichen Modellierungsschemas. Für die konzeptionelle und qualitative Weiterentwicklung der Wegeforschung wird deshalb im Vorfeld die GIS-gestützte Standortanalyse als wichtiges Entwicklungsziel vorgeschlagen. Auch für die traditionelle, praktische Suche nach (prä-)historischen Wegen kann eine alternative Vorgehensweise vorgelegt werden: Statt der üblicherweise methodisch erforderlichen Start- und Zielpunkte dienen die allgemein gültigen Kriterien von Wegen, und statt einer „weißen“ Landkarte dient das digitale neuzeitliche Wegenetz um 1800 als Grundlage der Modellbildung.<br><br>Kernstück der vorliegenden Arbeit bildet der Kriterienkatalog, der auf Grundlage der interdisziplinären Wegeforschungen erstmals allgemein gültige, empirisch ermittelte Merkmale von Landwegen zusammenfasst. Die kritische Durchsicht und Zusammenfassung von Veröffentlichungen aus der klassischen und archäologischen Altstraßenforschung bildet mit einer großen Anzahl von empirischen Annahmen den Ausgangspunkt. Die Auswertung der Entstehung und Entwicklung von Wegen bestätigen viele der ermittelten Kriterien und ergänzen diese um einige Ausprägungen. Die strukturellen Modelle der archäologischen Quellenfilter und Taphonomie können für die Beschreibung der Kriterien eingesetzt werden. Aspekte aus der Landschafts- und Städteplanung bzw. Verkehrspsychologie liefern abschließend gute Erklärungen für viele Annahmen. Jedes der 71 Kriterien wird systematisch und begründet dargelegt, die räumlichen, zeitlichen sowie technischen Einschränkungen und Überlieferungs- bzw. Auffindungsprobleme beschrieben und kann so nachvollziehbar für die Suche und Identifizierung von Wegen eingesetzt werden.<br><br>Im Rahmen einer Studie am westlichen Bodensee/Hegau werden ausgewählte Faktoren aus dem erstellten Kriterienkatalog stichprobenartig eingesetzt und deren Möglichkeiten bewertet. In der Tradition der historisch-geographischen Forschungen wird das gesamte Wegenetz zunächst aus zwei neuzeitlichen Kartenwerken vor und nach 1800 digital erfasst, wobei Kriterien des Kriterienkatalogs bereits als Hilfsmittel zur Rekonstruktion zum Einsatz kommen. Für die Suche nach Wegen werden in Anlehnung an die archäologischen Vorhersagemodelle zum einen naturräumliche Kriterien wie Hangneigung, Exposition, Lage im Hang und gut geeignete Bodentypen ausgewählt. Zum anderen können aufgrund der Nutzung der Kartenwerke Anomalien und Wüstungen im Wegenetz entdeckt und verwendet werden. Hierzu werden scharfe Knicke im Wegeverlauf und Sackgassen dokumentiert und ihre hypothetischen Verlängerungen rekonstruiert. Erstmals werden auch Ausschlusskriterien wie anthropogen oder durch Erosion überprägte Flächen berücksichtigt. <br><br>Die entwickelte Vorgehensweise und die praktische Umsetzung sind grundsätzlich unabhängig von den üblichen Suchkriterien wie archäologische Befunde (Siedlungen, Grabhügel) oder LiDAR-Auswertungen. Diese könnten in einem weiteren Schritt zur Validierung eingesetzt werden. Weitere Ideen umfassen die detailliertere Auswertung der Wegeanomalien und Wüstungen, die Nutzung und Analyse von bisher kaum eingesetzten, aber kostenfrei verfügbaren Geodaten wie geologische Karten und die Entwicklung von Algorithmen für die automatische Identifizierung von Kriterien. So wäre auch die Erforschung von regionalen hydrogeologischen Landschaftsentwicklungen als Grundlage für die Suche nach Land-Wasser-Umschlagsplätzen möglich.<br><br>Die Suche und Identifizierung von (prä-)historischen Landwegen bleibt noch immer eine Herausforderung. Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass aufgrund der natürlichen raum-zeitlichen Dynamik von Wegen nie alle historischen Abschnitte erfasst werden können. Welche Kriterien für die jeweiligen archäologischen Kulturen wichtig waren bleibt ebenso offen. Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch, dass sich die Altstraßenforschung mit ihrem ursprünglichen mittelalterlichen Schwerpunkt und davon abgeleiteten Wegekriterien interdisziplinär auch in prähistorische Epochen weiterentwickeln kann. Die hier vorgestellte, systematische Vorgehensweise und die leicht zugänglichen und flächendeckend vorliegenden Kartenwerke erlauben zum einen eine solide Basis für die Rekonstruktion der historischen Wege und tragen zum anderen zu einer guten Übertragbarkeit auf andere Untersuchungsgebiete bei Abstract: The so-called „Altstraßenforschung“ (the research of historic roads) in Historical Geography is a phenomenon of a 150-year tradition in German speaking countries. In 1969, Prof. Dr. Dietrich Denecke introduced the scientific basis for countless research projects with his literally path-breaking dissertation. Since then, methods and tools driven by new techniques have been developed. Additionally, various scientific disciplines, e.g. Archaeology presented new approaches and concepts. Furthermore, extensive sources and digital geodata are available today. However, an updated, interdisciplinary overview of methods and theoretical models to prehistoric paths still remains a desideratum. The aim of this thesis is to develop a methodological approach allowing the identification of sections of (pre-)historical pathways using traditional historic road research („Altstraßenforschung“) as well as interdisciplinary research results.<br><br>Initially, on the basis of the geographical and archaeological research the object of investigation with its three components of street body, alignment and accompanying objects has to be defined and the various sources and challenges discussed. Furthermore, modern theories, concepts and models from various scientific disciplines, especially the archaeological sciences, extend this origi¬nal research approach of Historical Geography. For instance, archaeological mobility research for instance provides indirect evidence and analyzes the underlying causes and motivations. The model of „life cycle of durable elements“ and taphonomic processes helps restructuring older research results. Furthermore, the popular Archaeological least-cost path modeling predicts landscape corridors for potential pathways. Additionally, genesis and development of paths have to be rewritten by results of paleogenetics and isotope analysis on the early human migrations. Finally, studies of landscape and urban planning and traffic psychology document the physiological basis for mobility and perception as well as orientation and navigation in space. All these interdisciplinary components have to be critically analysed and evaluated individually: Which effects on the physical paths are to be expected ? Which new aspects can be contributed to future path research, including prehistoric paths in particular.<br><br>In geoinformatics, the spatial search for objects is usually carried out through GIS-based site selection, which is also used for least-cost path modeling. However, this methodology is only the second step of the scientific modelling scheme. The first step, the so-called location analysis is even more fundamental and therefore proposed as an important development objective. Also, an alternative approach is presented for the traditional, practical search for (pre-)historical paths. Instead of the usually methodically required starting and finishing points, general valid criteria of paths are used, and instead of a "white" map, the digital network of paths around 1800 build the basis of the modelling.<br><br>Key aspect of the present work is the catalogue of criteria, which summarises empirically determined properties of land routes developed on the basis of interdisciplinary road research for the first time. The critical review and summary of publications from Historical Geography and archaeological research forms the starting point with a large number of empirical assumptions. The evaluation of the genesis and development of paths confirms many of the identified criteria and leads to additional characteristics. The structural models of archaeological taphonomy are used to describe the criteria. Finally, aspects of landscape and urban planning or traffic psychology offer valuable explanations for many assumptions. In total, 71 criteria are defined and presented systematically and substantiated. Additionally, the spatial, temporal and technical restrictions as well as uncertainties of legacy and detection are described and thus, can be considered comprehensibly for the search and identification of paths.<br><br>A case study at the western part of Lake Constance is conducted, using selected criteria from the presented catalogue. In a first step, following the tradition of historical-geographical research, the entire network of paths is digitized on the base of two modern map series before and after 1800 and, the previously definded criteria are already applied to support reconstruction of the paths. The identification of paths is conducted by applying natural spatial criteria such as slope, exposure and hillside. Furthermore, suitable soil types corresponding to the archaeological prediction models are considered. Using the map series, the identification of anomalies and deserted parts of the path network is possible as well. For this purpose, sharp bends in the alignment and dead ends are documented and their hypothetical extensions reconstructed. Additionally, exclusion criteria such as anthropogenic affected areas as well as erosion-induced regions are also taken into account. <br><br>The developed procedure and its practical implementation are completly independent of the usual search criteria such as archaeological findings (settlements, burial mounds) or LiDAR interpretations. These could be applied in a further step of validation. Further research could for one include the more detailed evaluation of path anomalies and deserted areas. In addition, the analy¬sis of geodata that has so far been scarcely used such as geological maps can possibly broaden the range of criteria. Furthermore, algorithms for the automatic identification of criteria would facilitate the classification of historic pathways. The study of regional hydrogeological landscape developments can also help to identify land-water transhipment points.<br><br>The search for and identification of (pre-)historical land routes still remains a challenge. It is a scientific consensus that due to the natural spatio-temporal dynamics of routes, all historical sections may never be captured. Which criteria were important for the respective archaeological cultures also still remains open. However, the present work shows that the interdisciplinary research of historic pathways out of the so-called „Altstraßenforschung“ is not restricted to the original Medieval road investigations. The simple and transparent procedure, the theoretical models presenting location analysis and taphonomic processes and the practical implementation using the presented catalogue of criteria provide a reasonable basis for the reconstruction of the historical paths. Research can now also progress interdisciplinary into prehistoric epochs as well as into other study areas |
|---|