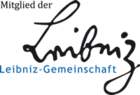| Zusammenfassung: |
Zusammenfassung: In den Jahren 2017, 2018 und 2019 waren vor allem in Ostdeutschland vermehrt Hitzeperioden mit hohen Temperaturen über 39 °C bei gleichzeitigen längeren Trockenzeiten zu verzeichnen. Dieses Phänomen ist mit der globalen Klimaerwärmung zu begründen und wird sich in den kommenden Jahren noch weiter verstärken. Die Folge davon ist, dass sich auch die Innenräume von Denkmälern mit wertvoller historischer Ausstattung aufheizen, und die relative Feuchte auf kritische Werte unter 40 % r.F. absinkt. Dieses Phänomen ist bisher in dieser Weise noch nicht aufgetreten – im Gegenteil, in historischen Denkmälern waren bislang eher zu hohe Luftfeuchten das Problem. Geringe Luftfeuchten führen zu einem hohen Schadensrisiko (Rissbildung, Lockerung und Substanzverlust der Farbfassung, etc.) für zahlreiche Kunstgattungen, speziell für polychrome Oberflächen, wie Leinwandgemälde, Papier- und Ledertapeten, gefasste Holzoberflächen sowie Wandmalerei. Diese Schadensphänomen ist bisher im Raum Sachsen und Sachsen-Anhalt vermehrt aufgetreten. Um es im nationalen Kontext besser einschätzen zu können, wurde ein Fragebogen hinsichtlich der Auswirkung des anthropogenen Klimawandels auf historische Denkmäler entwickelt. Dieser wurde von Mitarbeitenden an Denkmalämtern und Schlösserverwaltungen der jeweiligen Bundesländer beantwortet. Weiter erfolgte an Beispielen national wertvoller Ausstattung eine eingehende Analyse des Raumklimas inklusive des Mikroklimas an. Dazu wurden der Cranach-Altar der Schlosskirche der Augustusburg, die barocken Ledertapeten im Schloss Moritzburg, die Wandmalereien in der Albrechtsburg in Meißen sowie das Flügelretabel von St. Nicolai in Döbeln ausgewählt. Neben der Analyse des Raumklimas stand die Untersuchung der historischen Oberflächen in Hinblick auf dessen Veränderung aufgrund des vorherrschenden Klimas im Fokus. Hier wurden optische Verfahren, wie Streifenlichtscanning und hochauflösende Digitalaufnahmen eingesetzt. Außerdem wurde basierend auf den in Schloss Moritzburg gemessenen Klimadaten, ein Klimafile erstellt. Dieses wurde in der Klimakammer zur Untersuchung der Reaktion von Dummykunstwerken und Ledertapetenstücken aus Schloss Moritzburg eingesetzt. Die Reaktion darauf untersuchten die Wissenschaftler wiederrum mit optischen Verfahren. Die daraus abzuleitende Reaktionsgeschwindigkeit der wertvollen Oberflächen gibt Hinweise auf das künftige Schadensrisiko
|